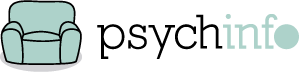Die Ankündigung der von der Psychotherapeutenkammer Berlin organisierten Veranstaltung erinnerte mich spontan an diverse Jugendliche bzw. junge Frauen türkischer, marokkanischer oder libanesischer Abstammung, die in den letzten Jahren bei mir in therapeutischer Behandlung waren. So unterschiedlich im Einzelnen die Symptomatik war, hatten alle Fälle eines gemeinsam: Die jungen Frauen litten unter einem eklatanten Konflikt zwischen der von der Familie vertretenen Herkunftskultur und ihrer westlichen großstädtischen Sozialisation.
Den unterschiedlichen Aspekten dieser umfassenden Problematik in therapeutischen Zusammenhängen widmeten sich zwei Vorträge, denen jeweils angeregte Diskussionen folgten.
Zunächst stellte Frau Diana Odening eine Hamburger Studie vor, die sowohl in Berlin (23 % Rücklauf) als auch in Hamburg (80 % Rücklauf!) der Frage nachging, inwieweit im Bereich der ambulanten Psychotherapie bereits eine "interkulturelle Öffnung" stattgefunden hat, was zumindest rein zahlenmäßig nicht ohne Weiteres bejaht werden kann. So haben im Bundesdurchschnitt nur 19 %aller approbierten Psychotherapeuten selbst einen Migrationshintergrund. Der Bologna-Prozess sowie die geltenden Ausbildungsordnungen erschweren für sie darüber hinaus den Zugang zur Versorgung. Frau Odening benennt auch die Hemmschwellen für eine höhere Inanspruchnahme von therapeutischen Angeboten auf Seiten der Patienten, wie z.B. ein differierendes Krankheitsverständnis oder divergente Wertesysteme. Die schwierigste Hemmschwelle seien aber auf jeden Fall immer wieder Sprachbarrieren, v.a. bei erwachsenen Patienten (Kinder und Jugendliche sind signifikant häufiger in therapeutischer Behandlung, da sie spätestens mit Eintritt in die Schule Deutsch gelernt haben).
In diesem Zusammenhang wurde relativ ausführlich diskutiert, inwieweit ein neutraler Dolmetscher(im Unterschied zu z.B. Angehörigen) hilfreich ist, oder - wie v.a. von psychoanalytischer Seite befürchtet - den Übertragungsprozess zu stark beeinflusst.
Inwieweit angesichts dieses Dilemmas die Beherrschung der Muttersprache des Patienten durch den Therapeuten von Vorteil ist, wurde u.A. von Frau Esin Erman in einem Bericht über ihre Arbeit als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin beleuchtet. Eine ihrer Kernaussagen war, dass der eigene Migrationshintergrund kein umfassendes Verständnis für die interkulturelle Problematik garantiere. Sie selbst habe sehr häufig ein Gefühl von Fremdheit; oft könne sie ihre Kulturzugehörigkeit nicht wirklich als Ressource nutzen (wobei ja davon auszugehen ist, dass Frau Erman ja wahrscheinlich maßgeblich in Deutschland sozialisiert wurde).
Sie stelle fest, dass von ihr beratene Migrantenfamilien sehr häufig aus sozial benachteiligten Schichten stammen und dass es eine starke Neigung gibt, psychosoziale Probleme zu somatisieren (von diesen Einsichten ausgehend wäre es sicherlich auch interessant zu untersuchen, inwieweit die interkulturelle Problematik auf spezifische Weise zu innerpsychischer Konflikt- und Symptombildung führen).
So wurden an diesem Abend (zufällig der internationale Tag gegen Rassismus) zahlreiche Aspekte der Thematik angesprochen, damit zusammenhängende Fragestellungen wohl eher aufgeworfen als endgültig beantwortet; er stimmte aber insofern optimistisch, als er ein Gefühl davon vermittelte, dass nur die intensive Beschäftigung mit den aufgezeigten "Baustellen" einen Prozess von Annäherung und Verständnis unterstützen kann.