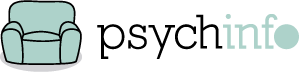In der Eröffnungsrede und später im Nachmittagsworkshop ging Kammerpräsident Michael Krenz dann auf die aktuelle, jedoch unzureichende und fehl gesteuerte Versorgungssituation in Berlin ein.
Die Bedarfsplanung ist auf dem Stand von 1993 stehen geblieben
Berlin sei an ambulanten psychotherapeutischen Angeboten zu 158% überversorgt - dieses Fazit ergibt sich aus den Berechnungen entsprechend der Bedarfsplanungsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses. Der Prozentanteil der ambulanten Praxissitze spiegele in keiner Weise den von Patienten und Psychotherapeuten real erlebten Versorgungsbedarf innerhalb der Stadt wider. Monatelange Wartezeiten auf einen Therapieplatz würden zumindest für den Patienten nicht das Gefühl einer regelhaften oder gar überhöhten Versorgung aufkommen lassen, im Gegenteil.
1993 habe der Gesetzgeber die Bedarfsplanung eingeführt, um eine Über- und Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung zu vermeiden. Seitdem hätten die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und die gesetzlichen Krankenkassen jeweils auf Landesebene einen Bedarfsplan zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung aufzustellen. Bei Kernstädten wie Berlin ergebe sich nach der Bedarfsplanungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundes-ausschusses (GBA) aus dem Jahr 2007 ein Versorgungsschlüssel von einem Psychothera-peut/Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut auf 2577 Einwohner. Aktuell werde die ambulante Psychotherapie in Berlin mit 1568 Psychotherapeuten abgedeckt. Ein Problem sei, dass der Versorgungsschlüssel immer noch auf Berechnungsgrundlagen aus dem Jahr 1993 resultiere. Der Versorgungsschlüssel sei nie dem aktuellen Bedarf der psychisch Erkrankten entsprechend angepasst worden.
Ungleiche Verteilung der Praxissitze in Berlin Ein weiteres Problem für Berlin ergebe sich laut Michael Krenz aus der ungleichen Verteilung der Psychotherapeuten-Praxissitze. Einige Bezirke gelten als eklatant unterbesetzt (Marzahn-Hellersdorf, Neukölln, Spandau z.B.), andere als drastisch überversorgt (Charlottenburg-Wilmersdorf; Steglitz-Zehlendorf oder Tempelhof-Schöneberg z.B.). Das Thema erhalte besondere Brisanz durch aktuelle Diskussionen um das bundesweit geplante Versorgungsge-setz und damit der Bedarfsplanungsrichtlinie. Die gesetzlichen Krankenkassen würden in diesem Zusammenhang massive Streichungen von Kassensitzen fordern. Das bedeute, ein Drittel der Kassensitze für Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten könnte in Berlin langfristig wegfallen.
Nicht nur Sitze zählen, sondern den Bedarf auch über die Morbiditätsorientierung und einer jeweils vorherrschenden Alterstruktur der Region steuern
Um die Bedarfsplanung sinnvoll zu reformieren, müssen tatsächliche Krankheitsdaten, de-mografische und sozialgeografische Entwicklungen (Alter, Geschlecht, Migration etc.) der einzelnen Bedarfsgebiete in Berlin aufgegriffen werden. Dies ließe sich über eine prospektive, wohnortnahe, sektorenübergreifende Bedarfsplanung am ehesten realisieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat bereits ein elektronisches geografisches Informationssystem (eGIS) entwickelt. Das System wird gespeist mit ambulanten und stationären Abrechnungsdaten, Daten aus dem Bundesarztregister, Arzneimitteldaten, Qualitätsberichten der Kliniken, Sterbedaten, Lebenserwartungen ab Geburt, sozioökonomischen Strukturdaten und Informationen durch Versichertenbefragungen zu Wartezeiten bei Arztpraxen, zur Wahl des Transportmittels für den Arztbesuch oder zum Ernährungsverhalten. Die Daten wurden auf einer einheitlichen (kleinräumigen) geografischen Ebene zusammengeführt und verdichtet und damit vergleichbar gemacht. Es werden die Daten mehrerer Jahre erfasst, sodass auch Zeitreihenanalysen möglich sind. Für eine anspruchsvolle und einer dem tatsächlichen Bedarf angespassten Versorgungsplanung bietet das eGIS viele Möglichkeiten.
Unabdingbar für die Bedarfsplanung sei - so die Ausführungen von Kammerpräsident Michael Krenz weiter - die Beteiligung der jeweiligen Standesorganisationen wie z.B. die Ärzte- und Psychotherapeutenkammern. Beide Heilberufekammern würden die Berufsaufsicht der ärztlichen und psychotherapeutischen Leistungserbringer wahrnehmen und diese bei der Umsetzung einer qualitativ hochwertigen Behandlung unterstützen.
Gabriela Leyh, Leiterin der vdek-Landesvertretung Berlin-Brandenburg, schloss sich der Auffassung von Krenz an, dass in den Planungsgremien die GKV und die Kammern integriert werden müssten. Es bestehe eine rechnerische Überversorgung sowie eine ungleiche Vertei-lung der Leistungsanbieter. Frage sei, wie bekomme man eine bessere Verteilung der unter-versorgten Regionen hin. Ihrer Ansicht nach müssten Anreize und Motivationen geschaffen werden, damit Psychotherapeuten auch in unterversorgte Gebiete gehen. Mit den Hausärz-ten müsste es stärkere Kooperationen geben.
Psychische Erkrankungen weiterhin auf hohem Niveau
Prof. Dr. Hans-Ulrich Wittchen von der TU Dresden legte die Prävalenzdaten der erwachsenen EU-Bevölkerung, die an einer psychischen Störung (nach DSM IV) erkrankten, vor. Die Jahresprävalenz lag bei 27%. Das entspreche 14-16 Millionen Menschen in Deutschland, die in den letzten 12 Monaten an einer psychischen Störung erkrankt waren. Das Risiko, mindestens einmal im Lebensverlauf an einer psychischen Störung zu erkranken (Lifetime-Prävalenz), liege sogar bei über 50%. Es seien vor allem somatoforme Störungen, Angststörungen und Depressionen unter den psychischen Störungen vertreten. Bei den Zahlen blieben Kinder- und Jugendliche sowie über 65-Jährige unberücksichtigt. Wittchen ergänzte jedoch, dass über 50% aller psychischen Störungen vor 20. Lebensjahr beginnen würden.
Neu für die meisten Tagungsbesucher war, dass nur rund die Hälfte aller 12-Monatsfälle überhaupt die Indikationskriterien für Psychotherapie erfüllen würden. Das entspreche bundesweit der Zahl von 7,5 Millionen. Allerdings gilt zu berücksichtigen, dass Patienten mit psychischen Störungen oft von Hausärzten, Beratungsstellen und Nervenfachärzten mitbehandelt werden. Aber ein Großteil psychischer Störungen bleibe einfach unbehandelt, bei den Depressionen ist es jede zweite Erkrankung.
Effektive Therapien erfordern Spezialisten, Wirksamkeitsnachweise und einen umfassenden und bedarfsgerechten Einsatz
"Psychische Erkrankungen sind nicht nur Befindlichkeitsstörungen - sie erfordern einen stadien-spezifisch unterschiedlichen Interventionsbedarf", so Prof. Wittchen. Hinsichtlich der Diagnostik müsse noch viel getan werden. Im Moment hätten wir extrem niedrige Erkennens- und Behandlungsraten. Würden medikamentöse und psychotherapeutische Therapien effektiv eingesetzt werden, könnten die Prävalenz und die Krankheitslast durch Psychische Störungen nach den Ausführungen von Prof. Dr. Hans-Ulrich Wittchen um 32% gesenkt werden.
Bezüglich der Primärprävention von psychischen Erkrankungen (definiert als Senkung der Neuerkrankungsrate) gebe es noch kein einziges auf Wirksamkeit nachgewiesenes Modell, wohl aber Erfahrungen aus effektiven sekundärpräventiven Ansätzen (z.B. bezüglich Sucht, Depression, Suizid, primäre Angststörungen).
Nach Vorstellung von Wittchen müsste vor allem auch die Versorgung von Patienten mit akuten schweren psychischen Störungen intensiviert werden (z.B. zeitlich verdichtet, halbtags oder tagkliniknah). Notwendig seien optimierte Kombinationstherapie-Modelle (medikamentös und psychotherapeutisch). Auch diese gelte es zu erproben und deren Wirksamkeit nachzuweisen.
Hinsichtlich der optimalen Ausfüllung des Sicherstellungsauftrages bräuchten die Planungs-verantwortlichen, so Wittchen, verlässliche, der Realität entsprechende Versorgungsdaten. Gute Planungsdaten würden auch Auskunft über die Versorgungskapazität der Erbringer beinhalten. Wittchen merkte kritisch an, dass viele Psychotherapeuten ihren KV-Sitz nicht entsprechend ihren Kapazitätsmöglichkeiten ausfüllen würden. Probatorische Sitzungen würden häufig nicht ausgeschöpft werden.
Die beteiligten Fachgruppen müssten nach Ansicht von Wittchen einen Konsensus über prioritär zu sehende Psychotherapieleistungen herstellen (d.h. Definition der Akut-Fälle, Anwendung der psychotherapeutischen Verfahren). Wenn die Voraussetzungen für eine adäquate Versorgung nicht fach- und gremienintern geregelt werde, würden die Psychotherapeuten als Leistungserbringer etwas "noch Unpassenderes übergestülpt" bekommen oder den "Verlust von Psychotherapie als Regelleistung der Kassen" verlieren.
Versorgung muss bezahlbar bleiben
Bundestagsabgeordneter Prof. Dr. Karl Lauterbach demonstrierte anhand von Hochrechnungen, wie sich künftig die GKV-Beiträge entsprechend dem GKV-Finanzierungsgesetz und die Ausgaben für Gesundheitsleistungen entwickeln werden. Der Arbeitgeber-Anteil von 7,3% bleibt nach dem GKV-Finanzierungsgesetz festgeschrieben. Der Arbeitnehmerbeitrag werde sich drastisch nach oben entwickeln. Dieser setzt sich zusammen aus einem 7,3% festgeschriebenen AN-Beitrag, einem 0,9%igem Sonderbeitrag und einer aufwachsenden Kopfpauschale, die das gesamte künftige Defizit decken müsse. Vor dem Hintergrund der Demografieentwicklung werde dieses Modell keinen Bestand mehr haben. Es komme nicht so viel Geld ins System rein, wie viel tatsächlich für die Ausgaben notwendig wäre. Der Rot-stift werde - so die Einschätzung von Lauterbach - voraussichtlich bei antragspflichtigen Leistungen angesetzt. Für die Psychotherapie wäre das natürlich fatal. Schwer psychisch kranke Menschen, die dringend eine psychotherapeutische Behandlung benötigen, aber einkommensmäßig schlecht gestellt sind und sich damit keine private Krankenzusatzversi-cherung leisten können, könnten eine längerfristige psychotherapeutische Behandlung nicht mehr in Anspruch nehmen.
Dieter Best, Bundesvorsitzender der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung (DPtV), betonte, dass der Professionalisierungsprozess der Psychotherapie weit vorangeschritten sei und Psychotherapie ihren Stellenwert behalten müsse. "Psychotherapie ist zu einer wichtigen Säule des deutschen Gesundheitswesens geworden. Der Wert der Psychotherapie, nicht nur bei der Behandlung psychischer Krankheiten, sondern auch bei körperlichen Krankheiten, bei denen psychische Faktoren beteiligt sind", werde zunehmend erkannt. Es fehle seiner Ansicht nach an einem erweiterten Behandlungsrepertoire. Dazu müssten die Psychotherapierichtlinien verändert werden. Wenn z.B. Gruppentherapien durchgeführt oder Psychotherapie bei bestimmten Patientengruppen anlassbezogen durchgeführt werden könnten, könn-te nicht nur inhaltlich profitiert werden. Die flexiblere Handhabung psychotherapeutischer Leistungen könnte auch dem System Geld sparen helfen.
Psychotherapeutenkammer Berlin wird sich als kompetenter Entscheidungs- und Meinungsträger aktiv in die Gesundheitspolitik einmischen
In Folge des 1999 erlassenen Psychotherapeutengesetzes konnten sich die Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zu zwei eigen-ständigen Berufsständen neben anderen Heilberufen wie die der Ärzte mit direktem Zugangsrecht für Patienten entwickeln. Ab 2001 wurden Psychotherapeutenkammern gegründet, damit diese die Berufsaufsicht wahrnehmen und den Berufsstand in Politik und Gesellschaft vertreten können. Inzwischen hat sich die Psychotherapeutenkammer Berlin zu einem durchsetzungsfähigen und etablierten Partner in der gesundheitspolitischen Szene entwickelt. Daher wird sich die Kammer bei künftigen gesetzlichen Vorhaben (wie momentan das Versorgungsgesetz) als kompetenter Meinungs- und Entscheidungsträger aktiv mit einmischen.
Dr. Beate Locher, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Psychotherapeutenkammer Berlin
Kurfürstendamm 184, 10707 Berlin info@psychotherapeutenkammer-berlin.de, www.psychotherapeutenkammer-berlin.de Tel. 030 887140-13
Berlin, 10.05.2011